Inhaltsverzeichnis:
Einleitung: Warum das Thema Nachhaltigkeit für uns alle wichtig ist
Nachhaltigkeit ist kein abstraktes Konzept, sondern eine dringende Notwendigkeit, die unser tägliches Leben und die Zukunft unseres Planeten maßgeblich beeinflusst. Angesichts wachsender globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und sozialer Ungleichheit wird deutlich, dass ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir leben, produzieren und konsumieren, unumgänglich ist. Doch warum betrifft das Thema Nachhaltigkeit wirklich jeden von uns?
Unsere Entscheidungen – sei es beim Einkaufen, Reisen oder im Umgang mit Energie – haben direkte Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Die Ressourcen der Erde sind begrenzt, und ihr rücksichtsloser Verbrauch gefährdet nicht nur die Ökosysteme, sondern auch die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen. Nachhaltigkeit bedeutet daher, Verantwortung zu übernehmen und eine Balance zwischen den Bedürfnissen der Gegenwart und den Ansprüchen der Zukunft zu schaffen.
Ein nachhaltiger Lebensstil ist jedoch nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch eine Chance, die Lebensqualität zu verbessern. Weniger Abfall, bewusster Konsum und die Förderung sozialer Gerechtigkeit können positive Veränderungen bewirken – sowohl global als auch im eigenen Alltag. Jeder Schritt zählt, und gemeinsam können wir eine Welt gestalten, die auch für kommende Generationen lebenswert bleibt.
Was bedeutet Nachhaltigkeit? Eine klare Definition
Nachhaltigkeit beschreibt ein Prinzip, das darauf abzielt, natürliche, soziale und wirtschaftliche Ressourcen so zu nutzen, dass sie langfristig erhalten bleiben und zukünftigen Generationen in gleicher oder besserer Qualität zur Verfügung stehen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft und den Möglichkeiten der Erde zu schaffen, diese Bedürfnisse dauerhaft zu erfüllen.
Der Begriff findet seinen Ursprung in der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts, wo er erstmals verwendet wurde, um sicherzustellen, dass nicht mehr Holz geschlagen wird, als nachwachsen kann. Heute umfasst Nachhaltigkeit weit mehr als nur den Umweltschutz. Sie ist ein ganzheitliches Konzept, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander verbindet.
Eine klare Definition von Nachhaltigkeit lässt sich durch drei Kernfragen verdeutlichen:
- Ökologisch: Wie können wir die Umwelt schützen und natürliche Ressourcen bewahren?
- Sozial: Wie schaffen wir faire Lebensbedingungen und fördern gesellschaftlichen Zusammenhalt?
- Wirtschaftlich: Wie gestalten wir wirtschaftliche Prozesse so, dass sie langfristig tragfähig sind?
Nachhaltigkeit bedeutet also nicht Verzicht, sondern eine bewusste und zukunftsorientierte Gestaltung unseres Lebens. Es ist ein Ansatz, der darauf abzielt, sowohl individuelle als auch kollektive Verantwortung zu übernehmen, um die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zu sichern.
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit und ihre praktische Bedeutung
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und wirtschaftlich – bilden das Fundament für eine zukunftsfähige Entwicklung. Sie sind eng miteinander verknüpft und zeigen, dass Nachhaltigkeit nur dann erreicht werden kann, wenn alle drei Bereiche gleichermaßen berücksichtigt werden. Doch was bedeuten diese Säulen konkret, und wie lassen sie sich im Alltag umsetzen?
1. Ökologische Säule: Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Die ökologische Dimension zielt darauf ab, die Umwelt zu bewahren und die natürlichen Ressourcen der Erde verantwortungsvoll zu nutzen. Praktisch bedeutet dies, Maßnahmen zu ergreifen, die den Klimawandel bremsen, die Artenvielfalt schützen und die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden reduzieren. Beispiele sind:
- Verwendung erneuerbarer Energien wie Solar- oder Windkraft.
- Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, die ohne Pestizide und Monokulturen auskommt.
- Reduktion von Plastikmüll durch Mehrwegprodukte und Recycling.
2. Soziale Säule: Förderung von Gerechtigkeit und Lebensqualität
Die soziale Säule der Nachhaltigkeit konzentriert sich auf den Menschen. Sie strebt an, soziale Ungleichheiten zu verringern, den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu verbessern und Gemeinschaften zu stärken. Praktische Ansätze umfassen:
- Unterstützung fairer Arbeitsbedingungen und Bezahlung durch bewussten Konsum.
- Förderung von Diversität und Inklusion in allen Lebensbereichen.
- Engagement in lokalen Initiativen, die soziale Projekte vorantreiben.
3. Wirtschaftliche Säule: Langfristige Stabilität und Innovation
Die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit zielt darauf ab, wirtschaftliche Prozesse so zu gestalten, dass sie langfristig tragfähig sind, ohne die Umwelt oder die Gesellschaft zu belasten. Dies erfordert Innovationen und ein Umdenken in der Produktion und im Konsum. Beispiele für die praktische Umsetzung sind:
- Förderung von Unternehmen, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten.
- Investitionen in Technologien, die Ressourcen effizienter nutzen.
- Bewusster Konsum von langlebigen und reparierbaren Produkten.
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit zeigen, dass nachhaltiges Handeln nicht nur ein Ziel, sondern ein fortlaufender Prozess ist. Jede Entscheidung – sei es auf individueller, unternehmerischer oder politischer Ebene – kann dazu beitragen, diese Balance zu fördern und eine lebenswerte Zukunft zu sichern.
Der Klimawandel als dringender Handlungsaufruf
Der Klimawandel ist nicht länger eine abstrakte Bedrohung, sondern eine Realität, die sich in extremen Wetterereignissen, steigenden Meeresspiegeln und schwindenden Gletschern zeigt. Diese Entwicklungen sind ein deutlicher Handlungsaufruf, der sowohl von Regierungen als auch von Einzelpersonen ernst genommen werden muss. Die Ursachen des Klimawandels – vor allem der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 – sind bekannt, doch die Zeit zum Handeln wird immer knapper.
Warum ist der Klimawandel so dringlich?
Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen alle Lebensbereiche. Hitzewellen gefährden die Gesundheit, Ernteausfälle bedrohen die Ernährungssicherheit, und Überschwemmungen zerstören Lebensräume. Wissenschaftler warnen, dass eine globale Erwärmung von mehr als 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau unumkehrbare Schäden anrichten könnte. Um dies zu verhindern, müssen die CO2-Emissionen drastisch reduziert und nachhaltige Lösungen gefördert werden.
Was können wir tun?
- Förderung erneuerbarer Energien: Der Umstieg auf Solar-, Wind- und Wasserkraft kann den Ausstoß fossiler Brennstoffe erheblich verringern.
- Nachhaltige Mobilität: öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder und Elektrofahrzeuge sind klimafreundliche Alternativen zum Individualverkehr mit Verbrennungsmotoren.
- Bewusster Konsum: Weniger Fleischkonsum, regionale Produkte und eine Reduktion von Lebensmittelverschwendung tragen zur Senkung der Emissionen bei.
Globale Verantwortung und individuelle Beiträge
Während politische Maßnahmen und internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen essenziell sind, spielt auch das individuelle Handeln eine Schlüsselrolle. Jeder Schritt, sei es die Reduktion des Energieverbrauchs oder die Unterstützung nachhaltiger Projekte, bringt uns näher an das Ziel, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Der Klimawandel ist ein Weckruf – und wir alle sind gefragt, jetzt zu handeln.
Historische Entwicklung: Wie die Idee der Nachhaltigkeit entstand
Die Idee der Nachhaltigkeit hat eine lange Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Der Begriff selbst wurde erstmals 1713 von Hans Carl von Carlowitz, einem deutschen Forstwissenschaftler, geprägt. In seinem Werk „Sylvicultura Oeconomica“ beschrieb er das Prinzip, nur so viel Holz zu schlagen, wie durch Aufforstung nachwachsen kann. Diese frühe Definition zielte darauf ab, die Wälder als essenzielle Ressource für kommende Generationen zu bewahren.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich das Konzept weiter. Während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert rückte der Fokus auf die wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen, oft ohne Rücksicht auf ökologische und soziale Folgen. Erst im 20. Jahrhundert wurde Nachhaltigkeit wieder verstärkt thematisiert, insbesondere durch die wachsende Besorgnis über Umweltzerstörung und soziale Ungleichheiten.
Ein entscheidender Wendepunkt war die Veröffentlichung des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ im Jahr 1972 durch den Club of Rome. Dieser Bericht warnte vor den langfristigen Folgen eines ungebremsten Wirtschaftswachstums und forderte ein Umdenken im Umgang mit Ressourcen. In den 1980er Jahren prägte die Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen den Begriff „nachhaltige Entwicklung“, der als „Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden“ definiert wurde.
Ein weiterer Meilenstein war die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro, bei der die Agenda 21 verabschiedet wurde. Dieses Aktionsprogramm legte den Grundstein für globale und lokale Nachhaltigkeitsstrategien. Seitdem hat sich das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt, etwa durch die Einführung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen im Jahr 2015, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte umfassend berücksichtigen.
Die historische Entwicklung der Nachhaltigkeit zeigt, dass sie kein neues Konzept ist, sondern ein fortlaufender Prozess, der sich an die Herausforderungen der jeweiligen Zeit anpasst. Von der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts bis hin zu den globalen Nachhaltigkeitszielen unserer Gegenwart ist die Idee stets von der Notwendigkeit geprägt, eine Balance zwischen Mensch, Umwelt und Wirtschaft zu schaffen.
Individuelle Verantwortung: Nachhaltigkeit im Alltag umsetzen
Nachhaltigkeit beginnt bei jedem Einzelnen. Kleine, bewusste Entscheidungen im Alltag können in ihrer Gesamtheit einen großen Unterschied machen. Die individuelle Verantwortung, nachhaltig zu handeln, bedeutet nicht, das Leben komplett umzukrempeln, sondern schrittweise Veränderungen einzuführen, die langfristig Wirkung zeigen. Hier sind konkrete Ansätze, wie Nachhaltigkeit im Alltag umgesetzt werden kann:
- Bewusster Konsum: Hinterfrage vor jedem Kauf, ob ein Produkt wirklich notwendig ist. Setze auf Qualität statt Quantität und wähle Produkte, die langlebig, reparierbar und umweltfreundlich sind.
- Ressourcen schonen: Reduziere den Wasser- und Energieverbrauch, indem du einfache Maßnahmen ergreifst, wie das Ausschalten von Geräten im Standby-Modus oder das Verwenden von Energiesparlampen.
- Nachhaltige Ernährung: Entscheide dich für regionale und saisonale Lebensmittel, um Transportwege zu minimieren. Pflanzliche Alternativen und der Verzicht auf übermäßigen Fleischkonsum können ebenfalls einen positiven Einfluss haben.
- Mobilität überdenken: Nutze öffentliche Verkehrsmittel, fahre Fahrrad oder bilde Fahrgemeinschaften, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Für kurze Strecken ist Gehen oft die beste Option.
- Abfall vermeiden: Setze auf Mehrwegprodukte, vermeide Einwegplastik und trenne deinen Müll sorgfältig. Upcycling-Ideen können helfen, vermeintlichen Abfall in nützliche Gegenstände zu verwandeln.
- Bildung und Bewusstsein: Informiere dich über nachhaltige Themen und teile dein Wissen mit anderen. Je mehr Menschen sich engagieren, desto größer wird der Einfluss auf die Gesellschaft.
Individuelle Verantwortung bedeutet auch, Vorbild zu sein. Jeder kleine Schritt inspiriert andere, ebenfalls nachhaltiger zu handeln. Gemeinsam können wir durch bewusstes Verhalten im Alltag eine Veränderung bewirken und einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Welt leisten.
Beispiele und Lösungen für nachhaltige Lebensweisen
Nachhaltige Lebensweisen umfassen eine Vielzahl von Ansätzen, die dazu beitragen, Ressourcen zu schonen, die Umwelt zu schützen und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Dabei geht es nicht nur um Verzicht, sondern um bewusste Entscheidungen, die langfristig positive Auswirkungen haben. Hier sind einige konkrete Beispiele und Lösungen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen:
- Urban Gardening: Das Anlegen kleiner Gärten auf Balkonen, Dächern oder in Gemeinschaftsflächen ermöglicht es, eigene Lebensmittel anzubauen. Dies reduziert Transportwege und fördert den bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln.
- Sharing Economy: Plattformen für das Teilen von Gütern, wie Carsharing, Werkzeugverleih oder Kleidertausch, helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen und den Konsum zu reduzieren.
- Minimalismus: Weniger besitzen, dafür gezielt in hochwertige und nachhaltige Produkte investieren. Minimalismus reduziert nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern schafft auch mehr Raum für das Wesentliche im Leben.
- Nachhaltige Technologie: Die Nutzung von energieeffizienten Geräten und Technologien, wie Smart-Home-Systemen, kann den Energieverbrauch erheblich senken und den Alltag umweltfreundlicher gestalten.
- Reparatur statt Neukauf: Reparaturcafés und DIY-Anleitungen fördern die Wiederverwendung defekter Gegenstände und verhindern unnötigen Müll.
- Nachhaltige Bank- und Finanzprodukte: Investitionen in grüne Fonds oder die Nutzung von Banken, die ökologische und soziale Projekte unterstützen, tragen zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei.
- Community-Projekte: Lokale Initiativen wie Foodsharing oder Kleidertauschpartys stärken nicht nur die Gemeinschaft, sondern fördern auch nachhaltige Lebensweisen.
Diese Beispiele zeigen, dass nachhaltige Lebensweisen nicht nur umsetzbar, sondern auch bereichernd sein können. Sie fördern nicht nur den Umweltschutz, sondern auch ein bewussteres und oft erfüllteres Leben. Der Schlüssel liegt darin, Schritt für Schritt Veränderungen vorzunehmen und sich von der Idee leiten zu lassen, dass jeder Beitrag zählt.
Ressourcen für tiefere Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit
Wer sich intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchte, findet eine Vielzahl an Ressourcen, die fundiertes Wissen, praktische Anleitungen und Inspiration bieten. Von wissenschaftlichen Berichten bis hin zu interaktiven Plattformen – hier sind einige wertvolle Ansätze, um tiefer in die Materie einzutauchen:
- Berichte und Studien: Organisationen wie das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) oder der Weltklimarat (IPCC) veröffentlichen regelmäßig Berichte, die wissenschaftliche Erkenntnisse zu Klimawandel, Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung zusammenfassen.
- Online-Kurse und Webinare: Plattformen wie Coursera oder edX bieten Kurse zu Themen wie nachhaltige Wirtschaft, Klimapolitik oder umweltfreundliche Technologien an. Diese Kurse sind oft kostenlos oder zu geringen Kosten verfügbar.
- Bücher und Fachliteratur: Werke wie „Die Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome oder „Cradle to Cradle“ von Michael Braungart und William McDonough liefern tiefgehende Einblicke in nachhaltige Konzepte und innovative Ansätze.
- Interaktive Tools: CO2-Rechner, wie sie von Umweltorganisationen bereitgestellt werden, helfen dabei, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu analysieren und gezielte Verbesserungen vorzunehmen.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: Projekte wie die „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen oder lokale Bewegungen wie Transition Towns bieten praktische Handlungsmöglichkeiten und laden zur aktiven Mitgestaltung ein.
- Podcasts und Blogs: Formate wie „Sustainability Explained“ oder deutschsprachige Blogs wie „Utopia“ liefern regelmäßig aktuelle Informationen und Tipps für einen nachhaltigeren Alltag.
Diese Ressourcen bieten nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und Teil einer globalen Bewegung zu werden. Ob durch Weiterbildung, Austausch in Communities oder die Umsetzung neuer Ideen – der Zugang zu tiefgehenden Informationen ist ein entscheidender Schritt, um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen zu fördern.
Gemeinsam handeln: Nachhaltigkeit als globale Herausforderung
Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung, die nur durch gemeinsames Handeln auf globaler Ebene bewältigt werden kann. Kein Land, keine Organisation und keine Einzelperson kann die komplexen Probleme wie Klimawandel, Ressourcenknappheit oder soziale Ungleichheit allein lösen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft ist daher unverzichtbar, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
Internationale Kooperation als Schlüssel
Globale Herausforderungen erfordern globale Antworten. Internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen oder die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sind Beispiele für gemeinsame Anstrengungen, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Diese Initiativen setzen klare Ziele, wie die Begrenzung der Erderwärmung oder die Bekämpfung von Armut, und schaffen eine Grundlage für länderübergreifende Maßnahmen.
Die Rolle von Unternehmen und Innovationen
Unternehmen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, nachhaltige Praktiken in Wirtschaft und Produktion zu etablieren. Durch die Entwicklung innovativer Technologien, die Förderung einer Kreislaufwirtschaft und die Umstellung auf erneuerbare Energien können sie nicht nur ihre eigenen ökologischen Fußabdrücke reduzieren, sondern auch neue Standards setzen. Partnerschaften zwischen Unternehmen und Regierungen können zudem den Weg für groß angelegte, nachhaltige Projekte ebnen.
Die Macht der Zivilgesellschaft
Auch die Zivilgesellschaft ist ein entscheidender Akteur. Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion zeigen, wie stark der Einfluss von engagierten Bürgern sein kann. Sie sensibilisieren für dringende Themen, üben Druck auf politische Entscheidungsträger aus und fördern den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Nachhaltigkeit als globale Herausforderung erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen. Es geht darum, nationale Interessen mit globalen Zielen in Einklang zu bringen und dabei niemanden zurückzulassen. Nur durch ein kollektives Bewusstsein und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, können wir eine gerechtere und lebenswertere Welt für alle schaffen.
Fazit: Nachhaltigkeit verstehen und aktiv gestalten
Nachhaltigkeit verstehen und aktiv gestalten bedeutet, die komplexen Zusammenhänge zwischen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu erkennen und daraus konkrete Handlungen abzuleiten. Es reicht nicht aus, das Konzept nur theoretisch zu begreifen – die Umsetzung im Alltag, in Unternehmen und auf politischer Ebene ist entscheidend, um eine zukunftsfähige Welt zu schaffen.
Der Schlüssel liegt darin, dass jeder Einzelne seine Möglichkeiten ausschöpft, um einen Beitrag zu leisten. Ob durch bewusste Konsumentscheidungen, die Unterstützung nachhaltiger Initiativen oder die aktive Mitgestaltung in der eigenen Gemeinde – jeder Schritt zählt. Dabei ist es wichtig, sich nicht von der Größe der globalen Herausforderungen entmutigen zu lassen, sondern den Fokus auf die eigenen Handlungsspielräume zu legen.
Nachhaltigkeit aktiv zu gestalten, erfordert zudem einen Perspektivwechsel: Weg von kurzfristigem Denken hin zu langfristigen Lösungen. Dies gilt für den Umgang mit Ressourcen ebenso wie für soziale und wirtschaftliche Entscheidungen. Innovationen, Bildung und der Austausch von Wissen spielen dabei eine zentrale Rolle, um neue Wege zu finden und bestehende Strukturen zu verbessern.
Am Ende ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Chance. Sie bietet die Möglichkeit, Lebensqualität zu steigern, Gemeinschaften zu stärken und eine gerechtere Welt zu schaffen. Indem wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und mutig neue Ansätze verfolgen, können wir den Wandel aktiv vorantreiben und eine nachhaltige Zukunft für alle gestalten.
Produkte zum Artikel
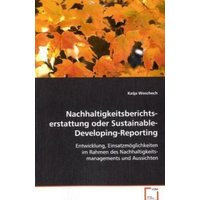
49.00 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

60.90 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
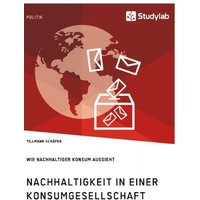
47.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
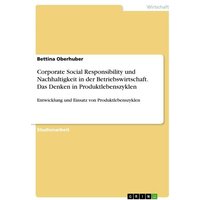
18.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
FAQ: Nachhaltigkeit leicht erklärt
Was bedeutet Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit beschreibt ein Prinzip, bei dem natürliche, soziale und wirtschaftliche Ressourcen so genutzt werden, dass sie auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Es geht darum, heutige Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten der Zukunft zu gefährden.
Welche drei Dimensionen hat Nachhaltigkeit?
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sind die ökologische, die soziale und die wirtschaftliche Säule. Sie umfassen den Schutz der Umwelt, die Förderung von sozialer Gerechtigkeit und eine langfristig tragfähige Wirtschaft.
Warum ist Nachhaltigkeit wichtig?
Nachhaltigkeit ist entscheidend, um den Klimawandel zu bremsen, Ressourcenknappheit zu verhindern und soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Sie sichert die Lebensgrundlagen für uns und kommende Generationen.
Wie kann jeder Einzelne Nachhaltigkeit im Alltag fördern?
Nachhaltigkeit im Alltag zu fördern, kann durch bewusstes Konsumverhalten, Müllvermeidung, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, nachhaltige Ernährung und umweltfreundliche Mobilität erreicht werden. Jeder kleine Schritt zählt.
Seit wann gibt es den Begriff Nachhaltigkeit?
Der Begriff Nachhaltigkeit geht zurück auf die Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Hans Carl von Carlowitz prägte ihn 1713, um sicherzustellen, dass nicht mehr Holz geschlagen wird, als nachwachsen kann.












